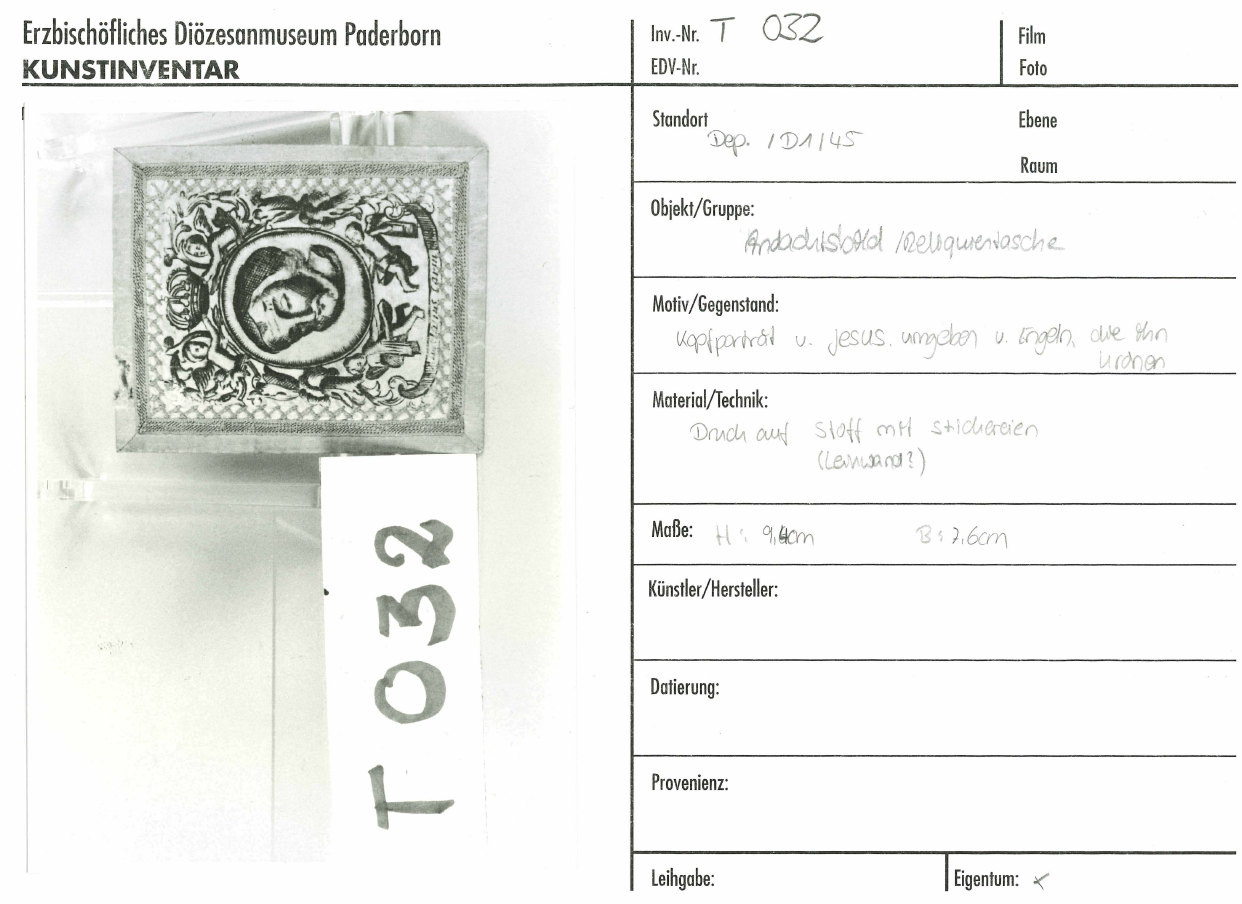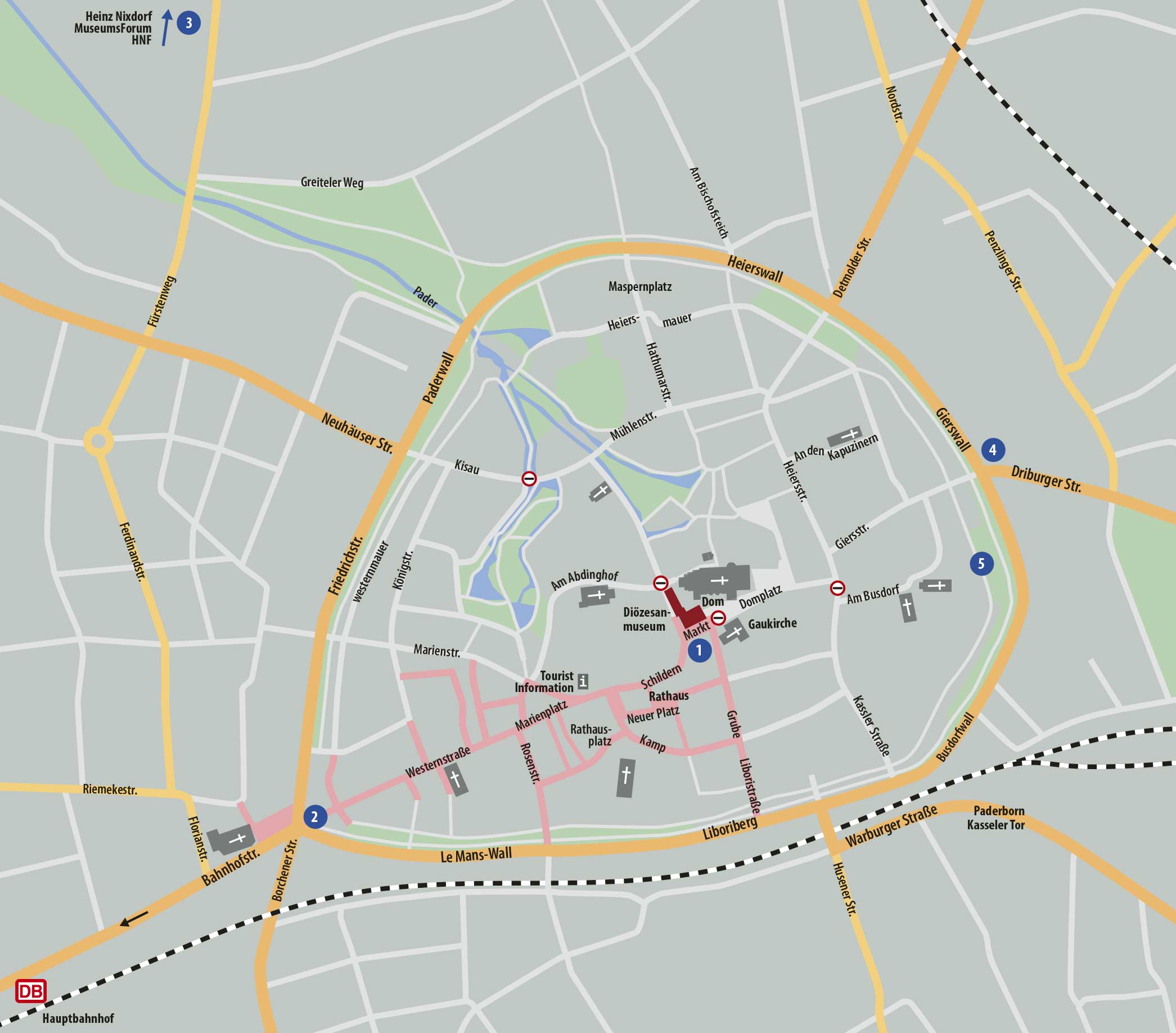Staunen und erwarten
Paderborn feiert den 100. Geburtstag von Josef Rikus. Stadtmuseum und Diözesanmuseum widmen ihm eine umfangreiche Doppelausstellung.
Überall ist von den großformatigen Werken des Bildhauers die Rede (Gierstorkreuz, Neptun-Brunnen etc.). Sie verstellen leicht den Blick auf seine Arbeiten im Kleinformat. Verdienen denn diese nicht genauso viel Aufmerksamkeit?
Wie die freien Arbeiten aus dem Frühwerk von Josef Rikus so zeugen auch viele der späteren Kleinbronzen vom ureigensten Ausdruck seines Gestaltungswillens. Denn anders als bei Werken für den öffentlichen Raum bedurfte es hier keinerlei Rücksichtnahme auf den Standort oder die Wünsche der Auftraggeber.
Beide Museen zeigen neben den Entwürfen für seine Großprojekte auch eine Vielzahl jener bemerkenswerten kleinen Arbeiten, in denen Rikus sein künstlerisches Empfinden ungestört formulieren konnte.

Da ist zum Beispiel die Kleinbronze mit dem Titel „Erwartung“.
Sie ist mehr für den Blick von oben als für die Ansicht auf Augenhöhe bestimmt. Fünf Menschen stehen dicht gedrängt. Die Körper sind verschmolzen zu einer Masse, aus der die Arme wie Tentakel zu allen Seiten in den Raum greifen. Ihre angewinkelten Beine ragen wie ausgestellte Stützen unter der zu einem Rumpf zusammengewachsenen Form hervor. Während die hinteren Gestalten noch dem unbestimmten Phänomen entgegendrängen, weichen die vorderen bereits davor zurück. Sie würden rückwärts fallen, gäben die vordrängenden Hintermänner ihnen keinen Halt. Die instabile Körperhaltung des Einzelnen sorgt in der Summe für den festen Stand der Gruppe. Wie die Kräfte eines jeden zur Stabilität des Ganzen beitragen, so summiert sich das in ihrer Gestik und Mimik zum Ausdruck kommende Empfinden zu einem überindividuellen Gemeinschaftserlebnis.
Doch was oder wen erwarten diese fünf Gestalten? Die geöffneten Münder, die geweiteten Augen, die gespannte Haltung, die gesamte Choreographie der staunend himmelwärts schauenden Gruppe schafft eine Atmosphäre, die wir von Ereignissen aus der Bibel kennen. Sie lässt an die Geschehnisse der Weihnacht denken, als die Hirten auf dem Felde der Erscheinung des Engels ansichtig wurden, oder an das Pfingstgeschehen. Vielleicht ist die Ursache auch ganz anderer, nämlich profaner Natur und die staunend hochblickende Gruppe schaut uns an, während wir sie betrachten.
Rikus verzichtete bei vielen seiner Werke bewusst auf eine eindeutige Darstellung. Wie die drei Punkte hinter einem nicht abgeschlossenen Satz regen sie die Phantasie an. Sie schließen das Zukünftige mit ein. Sie lassen ahnen, dass der hier festgehaltene Moment die dargestellte Handlung nicht abschließt. Sie lösen Assoziationen aus: Wie mag die Geschichte wohl weitergehen?
Das würden wir auch gerne wissen bei dem kürzlich abgebauten Gierstorkreuz. Es ist zurzeit in aller Munde und beschäftigt die Zunft der Leserbriefschreiber. Ein dickleibiger Band der „Denkmaltopographie der Bundesrepublik Deutschland“ hat das Kreuz bereits 2018 in den Adelsstand der denkmalwerten Kunstwerke erhoben. Voller Zuversicht hoffen wir nun auf die baldige Rückkehr des Kreuzes und darauf, dass hier nicht eine weitere Chance im Umgang mit bedeutender Kunst vergeben wird.
Zurzeit besteht die Chance, die kleinen Meisterwerke von Josef Rikus im Stadt- und im Diözesanmuseum aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen. Beide Häuser laden dazu ein. Alles steht bereit. Sie müssen nur kommen, sehen und staunen!
Hans-Ulrich Hillermann
Abbildungsunterschrift:
Josef Rikus: „Erwartung“, Bronze, 1986, Erzbischöfliches Diözesanmuseum Paderborn
Foto: Ansgar Hoffmann